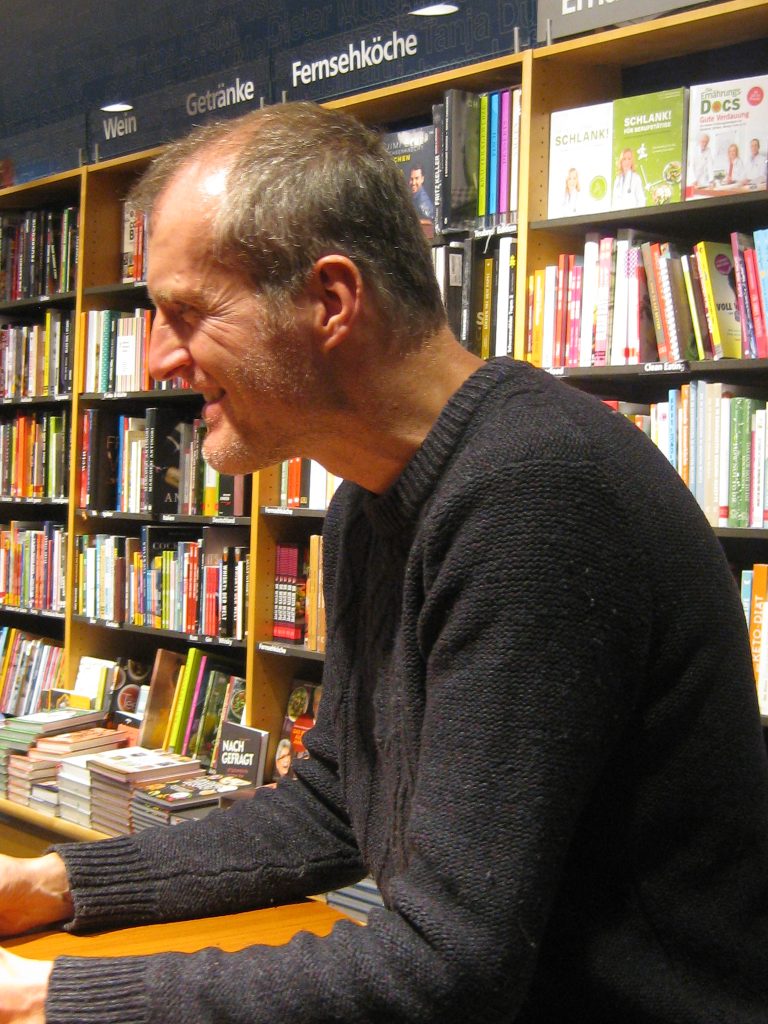4. Dezember 2018
Lesung von Sybille Lewitscharoff im Haus der Wissenschaft
„Was Sie gleich hören werden, ist bis jetzt noch keinem Publikum zu Ohren gekommen!“ Nichts weniger als eine Weltpremiere sei die Lesung von Sybille Lewitscharoff, kündigt Professor Jan Röhnert an. Auf Einladung des Instituts für Germanistik der TU las die Bachmann-, Büchner- und Raabepreisträgerin am Montag Abend im Haus der Wissenschaft. „Das Oszillieren zwischen dem Realistischen und dem Phantastischen macht den Zauber ihrer Romane aus.“ Und genau in diesem Zwischenreich ist die Lesung angesiedelt: es geht um Vogelflüge, poetische Höhenflüge und das Phänomen der Leviation. Vögel seien mächtige Geschöpfe, auf denen ein besonderer Glanz ruhe; in ihnen senke sich der Himmel auf die Erde herab, so Lewitscharoff. In den „Vogelgesprächen“ des persischen Dichters und Mystikers Fariduddin Attar (um 1136-1220/21) lässt der weise Vogelkönig Simurgh die kleineren Vögel an seiner Erkenntnis teilhaben. Er ist nahe dem Himmel, seine Ratschläge kleben nicht am Kleinen, sondern streben in die Höhe. Der Wiedehopf mit dem Krönchen als Zeichen seiner Gottesgesandschaft ist sein Vermittler, „man glaubt sofort, dass ein veritabler Prophet in ihm steckt“. Aus den „Metamorphosen“ Ovids liest Lewitscharoff unter anderem aus der grausamen Geschichte der Schwestern Philomela und Prokne. Sie rächen sich am thrakischen König Tereus, indem sie seinen kleinen Sohn zerstückeln und dem Vater zum Mahl vorsetzen. Auf der Flucht vor seinem Zorn werden sie zu Nachtigall und Schwalbe, der Verfolger zum Wiedehopf, „dem ein Busch auf dem Scheitel emporsteht, und unmäßig entragt mit langer Spitze der Schnabel (…) es erscheint wie gewaffnet das Antlitz.“ Und schließlich der eigene Roman „Das Pfingstwunder“ von 2016, in dem die Teilnehmer eines Kongresses in Rom zu Dantes „Göttlicher Komödie“ so euphorisch werden,